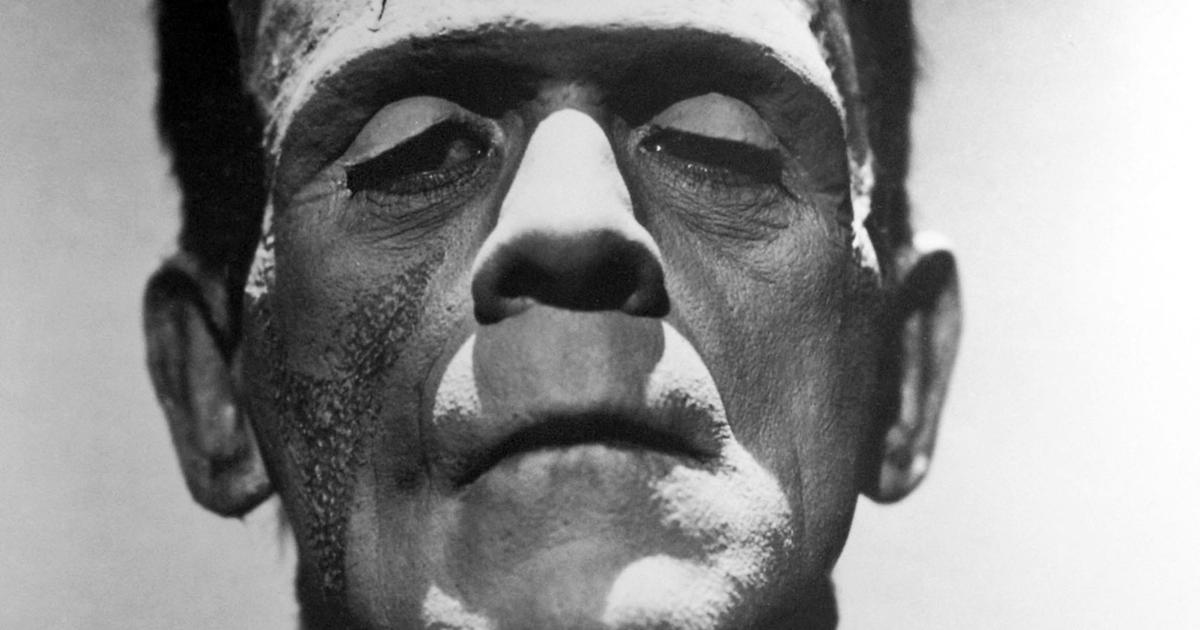Hörbücher und Podcasts in beschleunigtem Tempo hören oder nicht, das ist hier die Frage.
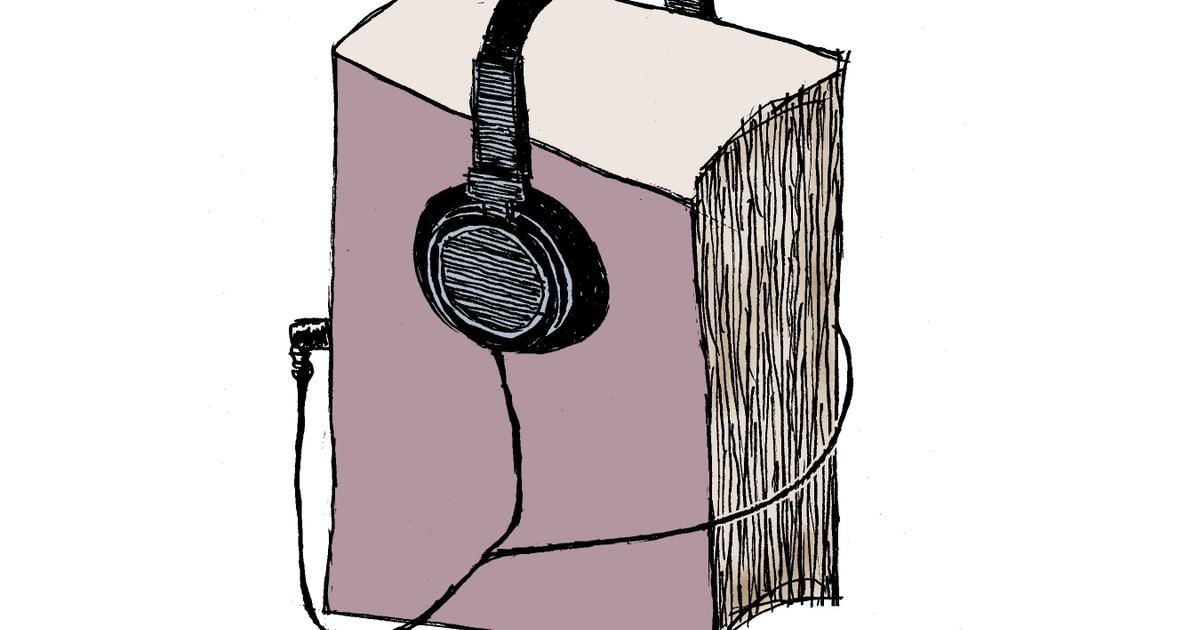
Von Netflix und YouTube bis hin zu Audible und Spotify bieten Plattformen ihren Nutzern die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen. Bis zu einem gewissen Grad bleibt die Informationsaufnahme zwar gleich, doch manche bevorzugen den ursprünglichen Rhythmus mit seinen Pausen und Seufzern gegenüber der Zeitersparnis durch beschleunigte Versionen.
Der Hollywood-Schwarm Glen Powell sagt, er höre Hörbücher am liebsten in normaler Geschwindigkeit (x1), „ich möchte, dass die Leute normal sprechen.“ Der amerikanische Schauspieler Bowen Yang hingegen bevorzugt eine schnelle und flüssige Erzählung. Seiner Meinung nach „kann man bis zu x2 gehen“, obwohl er x1,8 für Goldilocks als ideales Tempo ansieht.
Die beiden Männer traten Anfang des Jahres in einem Werbespot für die Hörbuchplattform Audible auf, in dem verschiedene Prominente über ihre Hörgeschwindigkeit bei ausgewählten Titeln sprachen. Der Beitrag löste eine hitzige Online-Debatte aus, da er suggerierte, dass diejenigen, die auf diese Weise Zeit sparen wollten, seltsam oder gar psychopathisch seien. „Ich habe mir eure moralisierende Werbung in doppelter Geschwindigkeit angehört“, spottete ein TikTok-Nutzer. Andere Internetnutzer, die mit der Kündigung ihrer Abonnements drohen, geben an, dass ihnen die Werbung „Schamgefühle“ bereitet habe.
Die durch diese Werbung ausgelöste Debatte verdeutlicht die Entwicklung digitaler Gewohnheiten, insbesondere unter jungen Menschen. Laut einer Umfrage von The Economist und YouGov nutzen 31 % der Amerikaner zwischen 18 und 29 Jahren den Schnellvorlaufmodus zum Abspielen von Audiodateien, verglichen mit nur 8 % der über 45-Jährigen.
Der Economist, eine bedeutende Institution der britischen Presse, 1843 von einem schottischen Hutmacher gegründet, gilt als Bibel für alle, die sich für internationale Angelegenheiten interessieren. Die dezidiert liberale Zeitschrift setzt sich im Allgemeinen für Freihandel, Globalisierung, Einwanderung und kulturellen Liberalismus ein. Sie erscheint in sechs Ländern, und 85 % ihrer Verkäufe werden außerhalb Großbritanniens erzielt.
Keiner der Artikel ist signiert: eine langjährige Tradition, die die Wochenzeitung mit der Begründung unterstützt, dass „Persönlichkeit und kollektive Stimme wichtiger sind als die individuelle Identität der Journalisten“.
Auf der Website von The Economist finden Sie neben den Hauptartikeln der Zeitung hervorragende thematische und geografische Berichte der Economist Intelligence Unit sowie Multimedia-Inhalte, Blogs und einen Kalender mit Konferenzen, die von der Zeitung weltweit organisiert werden. Zusätzlich erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Aktienkursen.
Das Cover des Magazins kann je nach Ausgabe (Großbritannien, Europa, Nordamerika, Asien) variieren, der Inhalt ist jedoch identisch. In Großbritannien enthält die Ausgabe zusätzlich einige Seiten mit nationalen Nachrichten. The Economist befindet sich zu 43,4 % im Besitz der italienischen Familie Agnelli, die restlichen Anteile halten prominente britische Familien (Cadbury, Rothschild, Schroders usw.) sowie Mitglieder der Redaktion.
Courrier International