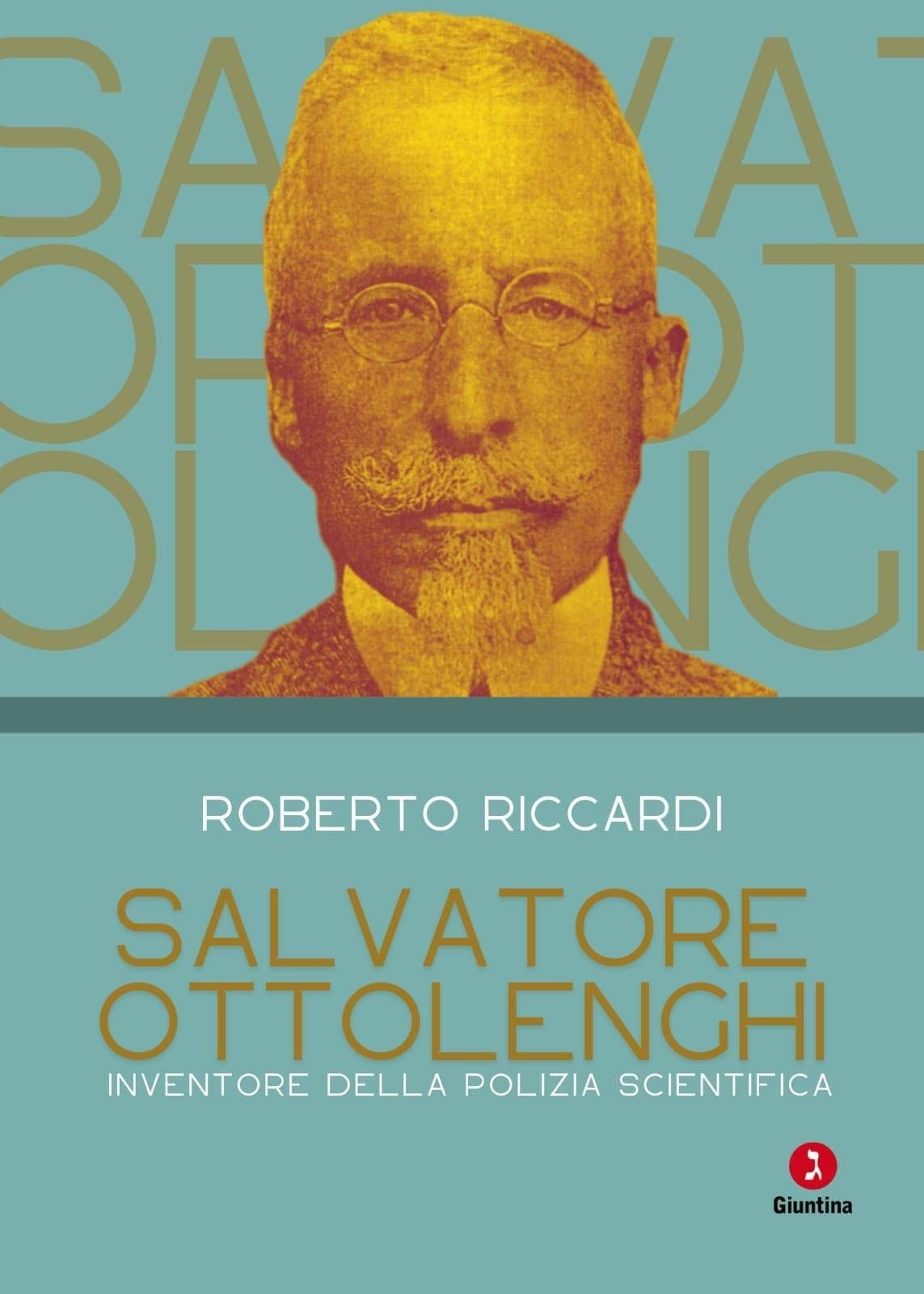Krieg in Büchern: Eine Umfrage darüber, was Russen lesen, um sich selbst zu verstehen
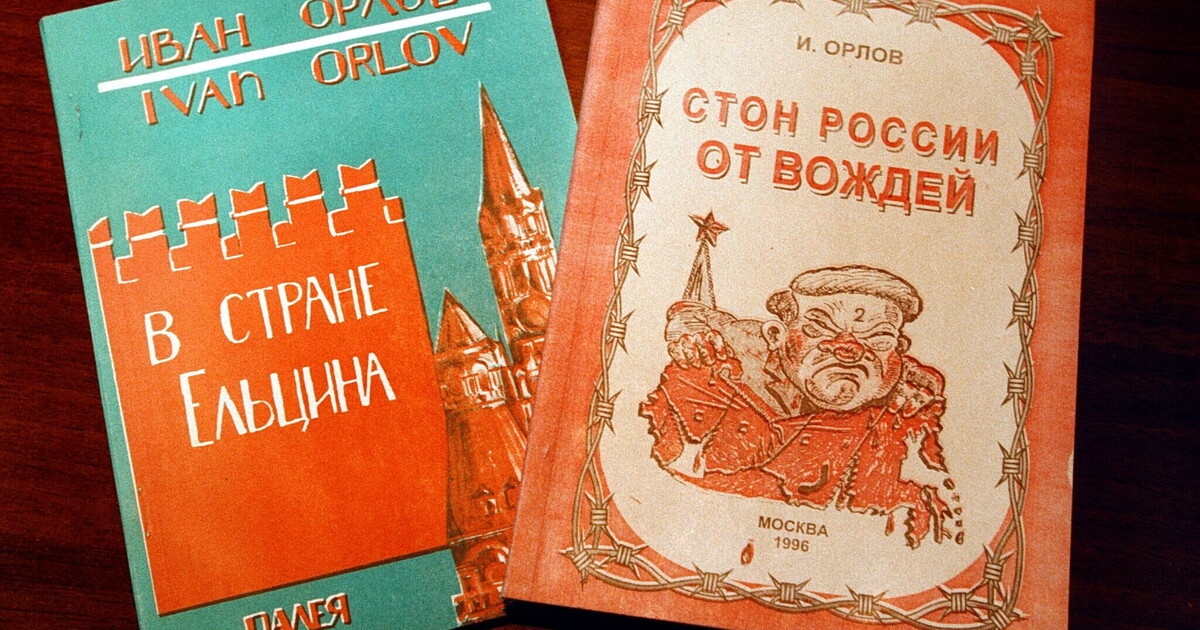
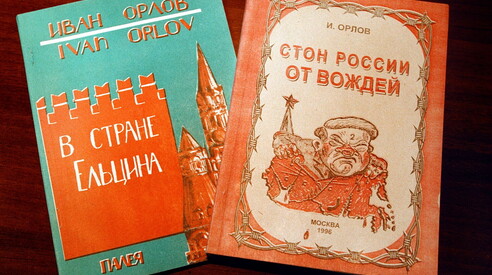
Ansa-Foto
Russische Lesungen
Weniger Kriegsverherrlichung, mehr Nachdenken. Nach dem Einmarsch in die Ukraine hat sich etwas im Leseverhalten der russischen Bürger verändert.
Nach dem Einmarsch in die Ukraine hielt der Krieg auch Einzug in die russischen Buchhandlungen. In den Monaten nach Februar 2022, als der Kreml die Zensurgesetze verschärfte, Gerichte jeden verurteilten, der es wagte, das Wort „Einmarsch“ auszusprechen, und die Medien die Rhetorik der „Entnazifizierung“ wiederholten, suchten die Leser in Geschichtsbüchern und Romanen nach einer Sprache, die ihnen Orientierung bot. Anfänglich folgten sie den von der Propaganda vorhergesagten Erwartungen: Sie entdeckten den Mythos des „Großen Vaterländischen Krieges“ wieder, die epische Erinnerung an den Kampf gegen Nazideutschland . Bücher über den Widerstand in Stalingrad, Biografien sowjetischer Helden und Romane, die das kollektive Opfer feierten, dominierten erneut die Bestsellerlisten. Lesen bedeutete in jenen Monaten, sich zu beteiligen.
Dann änderte sich etwas.
Die junge Politikwissenschaftlerin Natalia Vasilenok führte zwischen 2018 und 2025 eine umfassende Studie zu den Lesegewohnheiten der Russen durch (die Studie ist online unter dem Titel „Reading Orwell in Moscow“ frei zugänglich). Sie kombinierte Daten der größten russischen Buchhandlung (Chitay-Gorod) mit Daten der Plattform LiveLib, der größten Online-Community russischer Leser. Mithilfe eines Textanalysemodells rekonstruierte sie die „latenten Themen“, die die russische historische Sachliteratur dominieren, und verfolgte deren Entwicklung nach Februar 2022. Das Bild, das sich ergibt, ist wandelbar und widersprüchlich: Von propagandistischen Darstellungen vollzieht sich ein allmählicher Wandel hin zu einem freieren, ja sogar subversiven Umgang mit Erinnerung. Tatsächlich ist bereits 2023 ein Tonwechsel erkennbar. Die Leser lesen weiterhin über den Krieg, aber nicht mehr nur, um ihn zu verherrlichen. Dieselben Texte, die einst den Nationalstolz befeuerten, werden nun anders interpretiert – als Instrumente der Reflexion oder des Zweifels. Wassili Grossmans „ Leben und Schicksal “ beispielsweise rückt wieder in den Fokus, nicht als Epos des sowjetischen Sieges, sondern als Roman über die Identitätskrise zwischen zwei totalitären Regimen. Auch Swetlana Alexijewitschs „ Gebrauchte Zeit: Leben in Russland nach dem Zusammenbruch des Kommunismus “ und „ Der Krieg hat kein weibliches Gesicht: Das Epos sowjetischer Frauen im Zweiten Weltkrieg “ werden neu interpretiert, als Untersuchungen zur Fragilität der Wahrheit und zur Gewalt der Macht.
Die Erinnerung an den Krieg selbst wird zur moralischen Frage. Vasilenok nennt dieses Phänomen „ambivalente Lesepraktiken“: Texte, die je nach Leser verschiedene Sprachen sprechen können. Ein patriotischer Roman kann als Parabel der Angst gelesen werden, ein Kriegstagebuch als Reflexion über Gehorsam. Geschichte wird so zu einer verschlüsselten Sprache. George Orwells „1984“ und „Farm der Tiere“, Hannah Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, Anne Applebaums „Gulag“, Timothy Snyders „Bloodlands“ und „Über die Tyrannei“ werden zu Bezugspunkten für all jene, die Analogien zur Gegenwart suchen. Hinzu kommen Horst Krügers „Das Haus, das explodierte“, die Memoiren eines jungen Deutschen, der in der Normalität des Nationalsozialismus aufwuchs und dann gezwungen war, mit seiner eigenen „Schuld ohne Verbrechen“ zu leben, und Tova Friedmans „Die Tochter von Auschwitz“, die Geschichte einer Überlebenden, die Erinnerung in eine Übung in Bewusstsein verwandelt. Diese Bücher prangern nicht offen an, sondern lehren uns, zwischen den Zeilen zu lesen. So zeichnen sich die Konturen eines stillen Wandels ab. In einem System, das Informationen kontrolliert und öffentliche Meinungsäußerung bestraft, wird Lesen zu einer Möglichkeit, zu denken, ohne sich preiszugeben. Die Foren und Kommentare auf LiveLib zeugen von einer vorsichtigen, anspielungsreichen Sprache, in der Begriffe wie „Schuld“, „Angst“ und „Scham“ die mittlerweile unaussprechlichen politischen Begriffe ersetzen. Geschichte dient dazu, das auszudrücken, was über die Gegenwart nicht gesagt werden kann. Selbst die Verlagsbranche scheint zu reagieren. Nach 2023 vervielfachen sich Bücher über moralische Dilemmata, den Alltag unter Regimen und die Banalität des Gehorsams; jene, die kollektive Größe feiern, nehmen ab. Es ist, als ob das Bedürfnis der Leser nach Sinn die Verlage gezwungen hätte, ein anderes Gleichgewicht zwischen Erinnerung und Rhetorik zu finden. Die Zielgruppe ist begrenzt: überwiegend jung, urban, gebildet und vernetzt. Doch gerade dort, in den exponiertesten Teilen der Gesellschaft, wird das historische Gedächtnis zum Terrain des Widerstands. Lesen ist nicht zwangsläufig ein politischer Akt, kann es aber unter bestimmten Bedingungen werden. In einem Russland, das Dichter und Philosophen inhaftiert, bleiben Bücher einer der wenigen Orte der Freiheit: die Möglichkeit, ungestört zu denken. In einem Land, das seine Legitimität auf der heroischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg gründet, ist das erneute Interesse an den Schattenseiten des 20. Jahrhunderts – Kollaboration, Feigheit, Angst – ein Zeichen für einen Riss in der offiziellen Erzählung. Es ist, als wäre das Bild des „Moskauer Orwell“, das der Titel von Vasilenoks Essay heraufbeschwört, kein bloßes intellektuelles Spiel, sondern das Porträt einer Öffentlichkeit, die, um in ihrer Zeit zu überleben, wieder lernt, zwischen den Zeilen zu lesen: ein neuer Weg, die Maschen einer immer erdrückenderen Zensur zu umgehen. Es ist die moralische Biografie eines Teils des heutigen Russlands, der stillschweigend in den Geschichtsbüchern anderer totalitärer Systeme blättert, um das eigene zu verstehen.
Mehr zu diesen Themen:
ilmanifesto