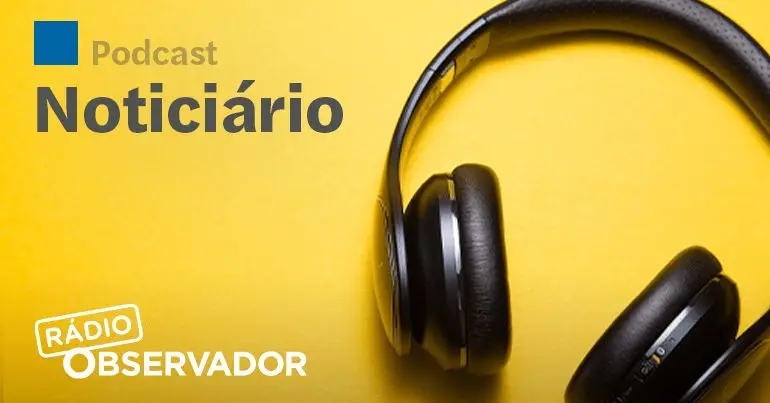Der Diplomat des Feldes

Bei seinen Besuchen auf der Roncador-Farm im Norden von Mato Grosso beobachtete der Junge das Kommen und Gehen der Rinder, die Cowboys mit ihren Herden und den ungetrübten Horizont inmitten des Cerrado. Es war das genaue Gegenteil des Lebens in São Paulo, wo die Aussicht von Gebäuden versperrt war. Die Ferien auf dem Land blieben als Erinnerung an Begegnung und Kontrast in Erinnerung, und Roncador war keine gewöhnliche Farm. Sie wurde von Pelerson Penido gegründet und war mit 153.000 Hektar das größte Anwesen des Landes. Sie spiegelte die damalige Vision wider: die brasilianische Entwicklung hing davon ab, das Landesinnere zu erschließen und es produktiv zu machen. Mit der Zeit wurde dieses Gebiet mehr als nur ein Ort der Kindheit. Die Bilder der Landschaft – die rote Erde, das metallische Geräusch der Maschinen, die Stille der frühen Morgenstunden – blieben als eine Art greifbare Erinnerung erhalten, die Jahre später wiederkehren sollte, als Pelersons Enkel beschloss, Brasilien aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Caio Penido Dalla Vecchia, heute 52 Jahre alt, erbte einen Teil des Bauernhofs und damit auch ein Dilemma, das viele Landwirte im Land kennen: Wie lässt sich die Produktivität steigern, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen? Aufgewachsen inmitten von Beton und Staub, lernte er früh, dass Brasilien aus Gegensätzen besteht und dass Land und Stadt, Produktion und Naturschutz näher beieinander liegen, als es zunächst scheint.
Bevor er endgültig nach Mato Grosso zurückkehrte, betrachtete er die Welt durch die Linse des Kinos. 2002 gründete er Encruzilhada Filmes, führte Regie bei dem Spielfilm *Um Homem Qualquer* (Jeder Mann) und dem Dokumentarfilm *Brasil Novo – Conflitos do Desenvolvimento* (Neues Brasilien – Entwicklungskonflikte), in dem er die Spannung zwischen Wachstum und Abholzung zu ergründen suchte. Nach seiner Rückkehr nach Roncador fand er ein völlig anderes Bild vor als in seinen Kindheitserinnerungen. Der Ackerbau hatte sich, angetrieben vom Sojaanbau, gegenüber der Viehzucht durchgesetzt. Die Veränderungen zeigten, dass sich die Landschaft rasant wandelte, nicht immer geordnet. Auf seinem Land begann Penido, neue Weidemanagement- und Regenerationsmethoden zu erproben und Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft zu kombinieren. Der Bauernhof, einst ein Symbol des Pioniergeistes der zentralwestlichen Region, diente fortan als Versuchsfeld für umweltschonendere Produktionsverfahren. „Es geht nicht nur um Entwicklung, aber auch nicht nur um Erhaltung“, erklärt er. „Man muss einen Weg finden, mit Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zu produzieren. Genau das versuche ich: einen Dialog zwischen den beiden Welten herzustellen, dem Produktionssektor und dem Umweltsektor.“
Seine Zeit beim Film hat ihn geprägt. Die dort gesammelte Erfahrung gab ihm das nötige Fachwissen, um seine Beobachtungen aus der Praxis zu vermitteln – einer Branche, die nach Effizienz strebt, aber gleichzeitig unter wirtschaftlichem und ökologischem Druck steht. Mit der Zeit erkannte der Viehzüchter, dass isolierte Veränderungen nicht ausreichen würden. Die Herausforderung bestand nicht darin, einen einzelnen Betrieb umzugestalten, sondern Netzwerke zu schaffen, die neue Praktiken unterstützen konnten. 2014 beteiligte er sich an der Gründung der Araguaia-Liga, einem Zusammenschluss von Erzeugern mit gemeinsamen Zielen. Die Gruppe begann mit bescheidenen Initiativen – Landbewirtschaftung, Weideverbesserung, Emissionsreduzierung – und erlangte Bekanntheit durch das Projekt „Araguaia Carbon“, das 79.000 Hektar Land überwachte, um einen Teil der Emissionen der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro zu kompensieren.
„Es geht nicht nur um Entwicklung, noch geht es nur um Erhaltung“, sagt der Geschäftsmann.
Weitere Projekte folgten. Dennoch stießen die Ergebnisse auf Widerstand: Die Debatte um Nachhaltigkeit in der Tierhaltung ist weiterhin von gegenseitigem Misstrauen zwischen Erzeugern und Umweltschützern geprägt. Aus diesem Grund profilierte sich Penido als Vermittler. Er begann, an Treffen und Foren teilzunehmen, die Regierungen, NGOs und Vertreter der Privatwirtschaft zusammenbrachten, wo die Gespräche meist angespannt verliefen. Seine Fähigkeit, zwischen den verschiedenen Agenden zu navigieren, führte ihn später zum Mato Grosso Institut für Fleisch (Imac), einer Einrichtung, die Erzeuger, Fleischverarbeitungsbetriebe und die Landesregierung vereint. Bei Imac erkannte Penido, dass der Sektor von zwei Seiten unter Druck stand: Zum einen die Forderungen nach Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von Umweltauflagen, zum anderen die Schwierigkeiten der Erzeuger, diese Regeln innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erfüllen. Das Institut entwickelte sich zu einer Anlaufstelle zwischen Umweltanforderungen und der Produktionsrealität.
Dort nahm das Projekt „Grüner Pass“ Gestalt an, das ein sozioökologisches Überwachungssystem für die Fleischlieferkette schaffen soll. Die Idee war, Informationen zu Herkunft, Regulierung und Einhaltung von Vorschriften auf einer integrierten Plattform zu sammeln, um Doppelprüfungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Das Programm entstand aus Verhandlungen mit der Bundesstaatsanwaltschaft, dem Gerichtshof und der Landesregierung und gliedert sich in zwei Bereiche. Der erste Bereich ist das Reintegrations- und Überwachungsprogramm, das aufgrund von Umweltverstößen gesperrten Erzeugern die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit durch Sanierungspläne ermöglicht. Die Maßnahmen werden per Satellit überwacht und von öffentlichen Stellen validiert. Der zweite Bereich ist marktorientiert: Private Audits sollen durch ein einheitliches, mit dem Landwirtschaftsministerium integriertes System ersetzt werden. Die Teilnahme ist freiwillig, soll aber bis 2033 auf den gesamten Sektor des Landes ausgeweitet werden.
Der Vorschlag stieß auf Widerstand. Einige Viehzüchter sahen in der Überwachung eine Form der Kontrolle, während Umweltschützer eine Lockerung der Umweltauflagen befürchteten. Die Debatte trieb die Weiterentwicklung des Modells voran, das fortan auf wirtschaftliche Anreize und Transparenz setzte, um seine Akzeptanz zu gewährleisten. „Die Viehhaltung verursacht Treibhausgasemissionen, doch in Brasilien werden Rinder auf der Weide gehalten. Hier gibt es sowohl Kohlenstoffemissionen als auch Kohlenstoffbindung. Es ist notwendig, die Bilanz zu berechnen. Brasilien verfügt über eine deutlich ausgewogenere Viehwirtschaft als Länder der Nordhalbkugel.“
Das „Grüner Pass“-Programm festigte Penidos Ruf als „Botschafter“, der als Vermittler zwischen Produzenten und politischen Entscheidungsträgern ohne Parteizugehörigkeit oder formale Vertretung agieren konnte. Diese Vermittlerrolle, die sowohl technische als auch politische Aspekte umfasste, führte ihn zur Teilnahme an Diskussionen über Dekarbonisierung, Rückverfolgbarkeit und Außenhandel. In den letzten Jahren nahm der Viehzüchter an internationalen Foren zu Klima und Lebensmittelproduktion teil. Im Rahmen von Fachmissionen in Europa und den USA präsentierte er Daten zur Rückverfolgbarkeit und Landnutzung. Die Herausforderung bei der COP30 besteht laut Penido darin, zu zeigen, dass Brasilien in der Lage ist, Produktion und Naturschutz auf Grundlage seiner eigenen Gesetze in Einklang zu bringen.
Der Junge, der zwischen Asphalt und Cerrado (brasilianischer Savanne) aufwuchs, versucht nun, zwei Welten zu verbinden. Vielleicht ist dies seine wichtigste Aufgabe: zwischen Interessen zu vermitteln, die sich selten überschneiden, und dabei die Widersprüche, die sie trennen, nicht zu vergessen. Und obwohl er Parteipolitik vorerst ablehnt, handelt er im Bewusstsein, dass der Dialog der einzige Weg nach vorn ist. „Die Agrarindustrie muss transparenter kommunizieren“, argumentiert er.
Veröffentlicht in Ausgabe Nr. 1387 von CartaCapital am 12. November 2025.
Dieser Text erscheint in der Printausgabe von CartaCapital unter dem Titel „Der Diplomat des Feldes“.
CartaCapital