Industrie 4.0 reicht nicht. Unternehmen müssen sich einer neuen Herausforderung stellen.

- Alventa ist ein wichtiger Lieferant von hochreiner Phosphorsäure in Europa (unter anderem für Unternehmen, die Chips und Halbleiter herstellen). Die Aufrechterhaltung der Produktionsqualität und der Schutz vor externen Störungen sind daher von entscheidender Bedeutung. Moderne digitale Lösungen sind hierfür der Schlüssel.
- In den letzten Jahren konzentrierte sich das Unternehmen auf die Digitalisierung der Produktion und die Transformation hin zur Industrie 4.0. Barbara Augustynek, Leiterin IT, und Marcin Cholewa, Vorstandsvertreter für ESG, berichten darüber.
- Das Gespräch ist Teil einer Interviewreihe, die als Grundlage für den Bericht „Vom Band zum Algorithmus. Wie die Digitalisierung die Zukunft der Industrie prägt“ dient, der von WNP Economic Trends im Rahmen des New Industry Forum (Katowice, 14.-15. Oktober 2025) erstellt wird.
Welche Investitionen im Bereich Digitalisierung haben Sie in den letzten fünf Jahren getätigt?
In den letzten fünf Jahren haben wir zahlreiche digitale Investitionen getätigt, die uns Schritt für Schritt dem Konzept der Industrie 4.0 näherbringen. Wir haben ein ERP-System zur Unterstützung von Produktions- und Managementprozessen implementiert, einen elektronischen Dokumentenfluss eingeführt und in ausgewählten Bereichen Robotik eingesetzt.
Gleichzeitig modernisieren wir unsere IT-Infrastruktur und bereiten sie auf die zunehmend größeren Datenmengen und die IT/OT-Integration vor.

Wie beurteilen Sie die digitale Reife Ihrer Organisation?
- Auf mittlerer Ebene – wir haben grundlegende Lösungen implementiert, sehen aber bewusst Potenzial für weitere Optimierungen. Die größten Chancen sehen wir in der IT/OT-Integration, dem Einsatz von KI und maschinellem Lernen sowie der Entwicklung von Monitoring und Datenanalyse.
Welche Digitalisierungsprojekte, insbesondere im Bereich Industrie 4.0, planen Sie für die nächsten Jahre?
Für die Zukunft planen wir weiteres Wachstum. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die weitere Prozessautomatisierung, die Stärkung der Cybersicherheit und die Implementierung von KI/ML-Optimierungstools. Wir erwägen außerdem Investitionen in Energie- und Emissionsüberwachungssysteme, um unsere ESG-Ziele und die CSRD-Berichtspflichten zu unterstützen.
Ein wichtiger Baustein zur Erfüllung der Vorschriften wird die Implementierung des Energiemanagementsystems ISO 50001 auf Basis digitaler Lösungen sein.
Unser Ziel ist es, einen Organisationsgrad zu erreichen, der das Potenzial von Industrie 4.0 voll ausschöpft.
Digitalisierung muss sich für das Unternehmen lohnen – und Kosten senkenWelche Kriterien dominieren bei der Entscheidung über solche Investitionen?
Wir stützen unsere Investitionsentscheidungen auf mehrere Faktoren. Die wichtigsten sind Kostensenkung, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktionseffizienz sowie die Gewährleistung von Qualität und Prozessvorhersehbarkeit.
Auch regulatorische Anforderungen und Kundenerwartungen spielen eine entscheidende Rolle und bestimmen zunehmend die Entwicklungsrichtung. Wir sehen auch, dass die Automatisierung dazu beiträgt, Personalengpässe auszugleichen, was auf dem aktuellen Arbeitsmarkt von unschätzbarem Wert ist.
Mit wem arbeiten Sie bei der Umsetzung der Digitalisierung zusammen – welche Barrieren sehen Sie auf nationaler Ebene?
Bei der Umsetzung der Digitalisierung arbeiten wir mit IT-/OT-Anbietern, Universitäten sowie Forschungs- und Entwicklungszentren zusammen. Wir legen zudem Wert auf die Zusammenarbeit mit Startups, die innovative Lösungen und neue Perspektiven einbringen.
Zu den größten Hindernissen bei der Digitalisierung von Unternehmen zählen die Kosten und komplexen Finanzierungsprozesse, die begrenzte Verfügbarkeit von IT-/OT- und KI-Spezialisten sowie die unzureichende digitale Kompetenz mancher Mitarbeiter. All dies verlangsamt zweifellos die Einführung neuer Technologien.
Was sind die Gründe für den geringen Einsatz von KI in Polen? In welchen Bereichen hat KI das größte industrielle Potenzial?
Meiner Meinung nach gibt es drei Hauptgründe für den geringen Einsatz von KI in Polen: mangelnde Datenreife (verstreut und nicht mit ERP/MES harmonisiert), Kostenbarrieren und unsichere Kapitalrendite – insbesondere in KMU – sowie ein Mangel an KI/OT-Spezialisten und eine eingeschränkte Experimentierkultur. Darüber hinaus spielen regulatorische Zurückhaltung und langwierige Beschaffungsprozesse eine entscheidende Rolle. Die Organisation der Daten ist entscheidend , denn ohne eine solide Grundlage sind KI-Implementierungen fragmentiert und ineffektiv.
Das größte Potenzial von KI liegt in der Prozessoptimierung – bei der Reduzierung des Energieverbrauchs, der Feinabstimmung von Produktionsparametern, der Logistik und dem Lieferkettenmanagement. Auch Prognose und Planung sind vielversprechend: Bedarfsprognose, Produktionsplanung und vorausschauende Wartung.
Welche Investitionen haben Sie im Bereich KI getätigt oder planen Sie?
Was haben wir bisher getan? Wir haben ausgewählte Prozesse automatisiert und organisieren die Datenebene. Was planen wir? Die Entwicklung von KI/ML-Tools für die Produktionsplanung, die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Forschungsinstituten sowie die Entwicklung analytischer Lösungen (Dashboards, KPIs) zur Unterstützung schnellerer und besserer Geschäftsentscheidungen.
Unser Ziel ist es, die digitale Reife schrittweise zu steigern, sodass KI ein integraler Bestandteil der Prozesse wird und nicht nur ein Add-on.
Die polnische Wirtschaft digitalisiert sich, allerdings mit unterschiedlichem TempoInwieweit unterstützt die Digitalisierung des polnischen Staates und seiner Produktions- und Managementprozesse die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele (ESG)? Inwieweit beziehen sich die von Ihnen implementierten digitalen Lösungen beispielsweise auf Energieoptimierung, CO2-Fußabdruck, Transparenz in der Berichterstattung und soziale Verantwortung?
Die Digitalisierung unterstützt zunehmend die Umsetzung von ESG-Zielen, wobei das Tempo des Wandels in Polen ungleichmäßig verläuft. Einerseits gibt es eine dynamische Entwicklung im E-Government, die die Berichterstattung und den Kontakt mit Institutionen erleichtert, andererseits weisen viele Unternehmen noch immer einen geringen digitalen Reifegrad auf.
In der Industrie bringt die Digitalisierung konkrete Ergebnisse: Die Automatisierung ermöglicht eine bessere Überwachung des Energie- und Versorgungsverbrauchs und erweiterte Analysen unterstützen die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und die Prozessoptimierung.
Wir implementieren zunehmend Energiemanagementsysteme, Berechnungen des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte und Lösungen für ein CSRD-konformes Reporting. Digitale Tools haben auch eine soziale Dimension – sie erleichtern die Kommunikation mit den Mitarbeitern und erhöhen die Transparenz gegenüber den Stakeholdern.
Letztendlich sehen wir in der Digitalisierung die Grundlage für ESG – sie vereint Umwelt, Gesellschaft und Governance in einem einzigen Daten- und Prozesssystem und ermöglicht es uns, Erklärungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.
Welche Auswirkungen haben die Digitalisierung und die umfassenderen Transformationen der Industrie 4.0 auf das Management und die Unternehmenskultur in Ihrem Unternehmen und werden diese zukünftig haben? Hat Ihr Unternehmen personelle Veränderungen vorgenommen, Mitarbeiter weitergebildet oder Transformationsleiter ernannt?
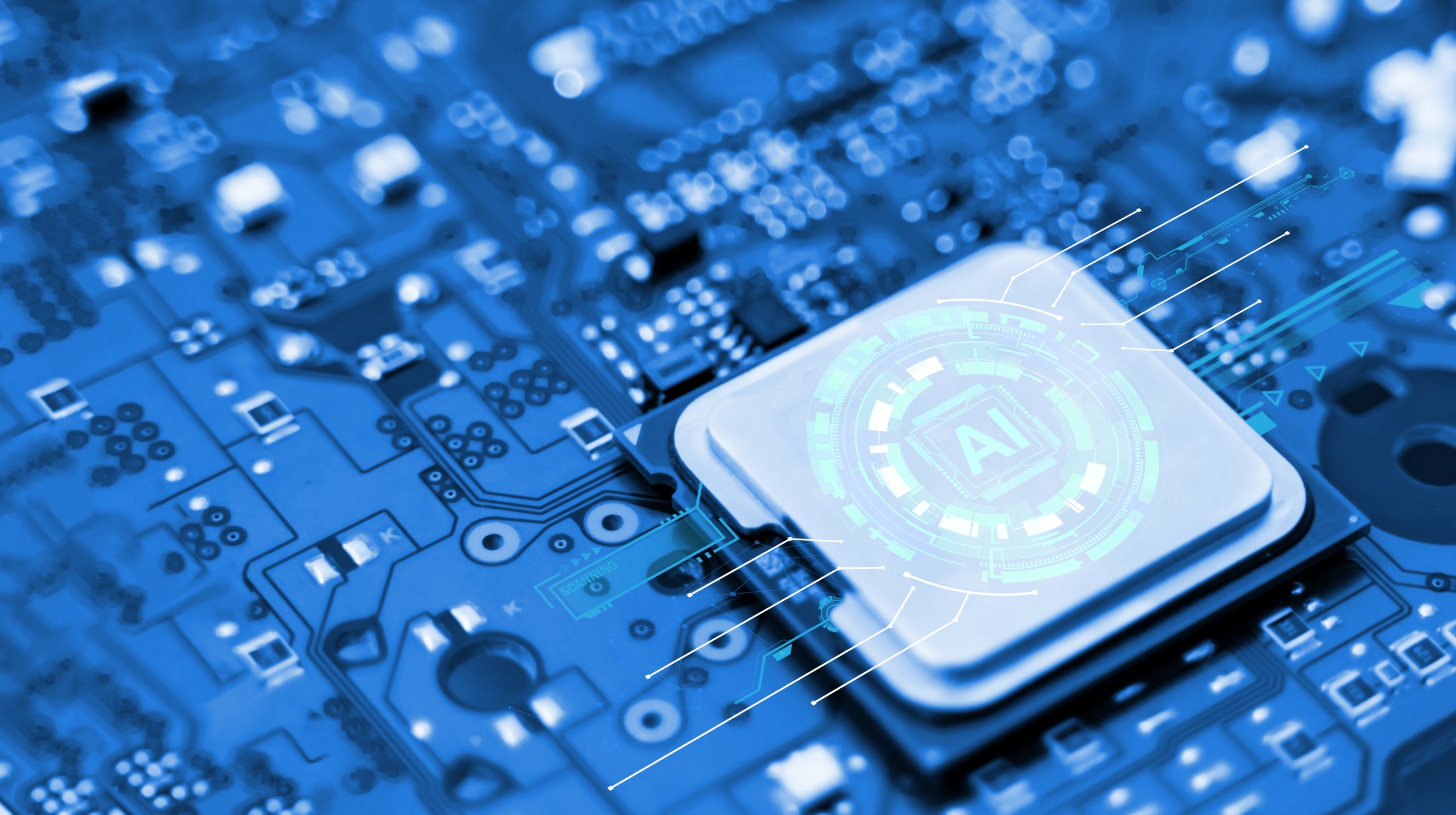
- Das Konzept der Industrie 4.0 beschränkt sich nicht nur auf Technologien im Bereich der Automatisierung, Robotik und Nutzung künstlicher Intelligenz, sondern betrifft in hohem Maße das Personalmanagement und die Organisationskultur.
Es beeinflusst die Art und Weise des Managements durch Dezentralisierung und agiles Management, stärker verteilt , beispielsweise auf der Ebene der Ingenieure oder der „Geräte“, die die Produktionsprozesse selbst steuern.
Die Aufgabe der Manager besteht darin, die Transformation zu unterstützen und zu leiten, das digitale Bewusstsein der Teams zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu erleichtern.
Wir legen Wert auf Innovation, sowohl durch die Suche nach schnellen Lösungen, durch Experimente an der „Basis“ der Organisation (beispielsweise durch das Kaizen-Programm) als auch durch die Suche nach innovativen Lösungen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Alventa kann auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken, doch um mit den Marktführern mithalten oder sie überholen zu können, konzentriert sich das Unternehmen auf die ständige Verbesserung seiner Qualifikationen, insbesondere in den Bereichen Datenanalyse, Umgang mit neuen Technologien und Qualitätsüberwachung.
Die Rolle des Mitarbeiters erweitert sich ständig und verschiebt sich von routinemäßigen, repetitiven Aufgaben, die von Maschinen ausgeführt werden können, hin zu analytischen, überwachenden und kreativen Aufgaben. Die Mitarbeiter sind in interdisziplinären Projektteams tätig.
Theorie ist nicht alles, Mitarbeiter brauchen auch PraxisWie beurteilen Sie das aktuelle System der Ausbildung von Fachkräften in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 im Allgemeinen? Welche Veränderungen sind notwendig und welche Rolle sollte der Staat und welche die Unternehmen spielen?
- Die Ausbildung – sowohl an technischen Universitäten als auch an Berufs- und weiterführenden technischen Schulen – ist nach wie vor zu theoretisch und hinkt häufig den technologischen Veränderungen und Anforderungen hinterher.
Dies ändert sich zwar in den letzten Jahren, dennoch mangelt es noch immer an modernen Laboren, Simulatoren und Einblicken in die Industrierealität. Besonders deutlich wird dies bei Praktika und der Einstellung von Absolventen – junge Menschen haben oft ein Idealbild von der Arbeit in einem Industrieunternehmen, das von der Realität abweicht. Erst im Unternehmen begegnen sie realen Problemen und Aufgaben und haben erstmals die Möglichkeit, moderne Laborgeräte zu nutzen. Sie selbst sagen, Studium und Industriearbeit seien zwei verschiedene Welten; mit dem Berufseinstieg lernen sie den Beruf neu kennen.
In Industrieunternehmen (aber nicht nur) sind Soft Skills von großer Bedeutung, wie etwa die Fähigkeit zur Teamarbeit und zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten, deren Entwicklung während der Ausbildung nicht immer mit dem Erwerb von Fachkenntnissen einhergeht.
Die Rolle des Staates sollte darin bestehen, die Bildungsinfrastruktur zu unterstützen, insbesondere jene, die auf den Erwerb praktischer Fähigkeiten ausgerichtet ist, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern und die Ausbildung zu subventionieren. Unternehmen wiederum sollten sich an der Mitgestaltung von Bildungsprogrammen beteiligen, Praktika und Ausbildungsplätze anbieten und in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um ihnen Möglichkeiten zur Umschulung und Kompetenzerweiterung zu bieten.
Ist das neue Konzept der Industrie 5.0 – die Kombination aus Technologie, nachhaltiger Entwicklung und Fokus auf den Menschen sowie der Krisenresistenz von Unternehmen – eine unausweichliche Entwicklung? Die Erwartungen an Unternehmen und Firmen steigen exponentiell und es wird immer schwieriger, sie zu erfüllen – sowohl organisatorisch als auch finanziell. Werden Unternehmen in der Lage sein, diese Erwartungen zu erfüllen?
- Anders als beim Konzept Industrie 4.0, das in erster Linie auf die Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung der Produktion sowie auf die Maximierung von Effizienz und Produktivität abzielt, spielen beim Konzept Industrie 5.0 die Rolle des Menschen, die soziale Verantwortung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle und gehen Hand in Hand mit Effizienz und langfristiger Krisenfestigkeit.
Diese Richtung – Industrie 5.0 – scheint unausweichlich – auch aufgrund der eingeführten gesetzlichen Anforderungen, wie etwa der ESG-Berichterstattung, aber auch der Erwartungen von Kunden, Mitarbeitern und Investoren.
Während die sich für Unternehmen im Zusammenhang mit der ESG-Berichterstattung ergebenden Schwierigkeiten die gesetzlichen Anforderungen zunächst lockern oder verschieben könnten, verfolgen Unternehmen – insbesondere internationale – unabhängig von gesetzlichen Anforderungen bereits seit einiger Zeit aktiv Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung und verlangen dies auch von ihren Lieferanten. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von Mechanismen bei Online-Ausschreibungen, die neben dem Preis auch andere Aspekte der Lieferantenleistung bewerten, vor allem die Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks.
Die Umsetzung des Konzepts Industrie 5.0 stellt Unternehmen auf verschiedenen Ebenen vor erhebliche Herausforderungen, vor allem auf finanzieller Ebene, da Investitionen in Dekarbonisierung, umweltfreundliche Technologien und Krisenresistenz erhebliche Investitionen erfordern. Es wird Jahre dauern, bis sich die Investition in dieses Konzept auszahlt, während die Unternehmen derzeit aufgrund der Lage der europäischen Wirtschaft, der Konjunkturabschwächung und der asiatischen Konkurrenz mit der Rentabilität kämpfen .
Das Problem besteht auch auf der Kompetenzebene: Den Unternehmen fehlen Mitarbeiter mit Kenntnissen in den Bereichen ESG, Change Management, KI-Implementierung und Cybersicherheit.
Da der Wandel hin zur Industrie 5.0 unausweichlich ist, könnten Unternehmen, denen die Anpassung an dieses Konzept schwerer fällt, Märkte und Mitarbeiter verlieren – ganz zu schweigen von der Fähigkeit, die für die Umsetzung der Veränderungen am dringendsten benötigten Mitarbeiter zu rekrutieren. Dies führt zu einer noch stärkeren Differenzierung: Größere Unternehmen gewinnen an Stärke, während schwächere Unternehmen mit geringeren Kapazitäten möglicherweise ganz aus dem Geschäft ausscheiden oder aufgekauft werden.
Auch die Beschaffung und der Austausch von Daten mit Partnern kann gefährlich sein.Wie schätzen Sie die Potenziale und Risiken der Datenerfassung und des Datenaustauschs mit B2B-Partnern (Lieferanten, Kunden) ein?
- Das Erfassen und Austauschen von Daten mit B2B-Partnern ist für den Aufbau effektiver Lieferketten und die Kostenoptimierung sehr wichtig.
Informationen über die Marktnachfrage und die Lagerbestände bei Ihren Handelspartnern bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Produktionsplanung, zur Minimierung der Lagerbestände und zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Störungen.
Darüber hinaus ermöglicht der Datenaustausch eine bessere Produktanpassung an die Kunden, die Entwicklung innovativer Lösungen und kann zu einer stärkeren Automatisierung der Einkaufs-/Verkaufsprozesse sowie einer höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisensituationen beitragen.
Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern in den Bereichen ESG und nachhaltige Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung. Der Austausch von Daten zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, zu Initiativen, Zielen und Berechnungsmethoden ist für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Aufbau von Wertschöpfungsketten von entscheidender Bedeutung.
Allerdings birgt die Datenbeschaffung und der Datenaustausch mit B2B-Partnern auch Risiken, wie etwa die Offenlegung sensibler Daten, den Erwerb von Kenntnissen über Produkte, Prozesse, Kosten, Margen und Lagerbestände und damit eine Verschlechterung der Verhandlungs- und Wettbewerbsposition von Unternehmen.
Diese Bedenken und das Misstrauen gegenüber einer intensiven Zusammenarbeit können ein Hindernis für den Datenaustausch darstellen. Aus diesem Grund findet diese Art der Zusammenarbeit eher zwischen Unternehmen statt, die auf der Grundlage enger Partnerschaft und gemeinsamer Entwicklung agieren und gleichzeitig die Grundsätze der Datensicherheit und die gesetzlichen Anforderungen, einschließlich NDAs (Vertraulichkeitsvereinbarungen – Anmerkung des Herausgebers), einhalten.
Wie beurteilen Sie das Bewusstsein und den Schutz vor Cyberangriffen in der Industrie? Welche Maßnahmen sollte die Politik diesbezüglich ergreifen?
Dieses Niveau steigt zwar, ist aber nach wie vor unzureichend und sehr unterschiedlich. Große, insbesondere internationale Unternehmen setzen hohe Standards gemäß ISO und der NIS2-Richtlinie um.
Das Problem tritt in kleineren und sogar in einigen großen Unternehmen auf – ihnen fehlen oft finanzielle und personelle Ressourcen, oder Cybersicherheit wird als Kostenfaktor wahrgenommen. Daher sind diese Unternehmen besonders häufig Ziel von Angriffen, deren Folgen wie Ransomware oder die Entführung von SCADA-Systemen ganze Prozesse lahmlegen können. Die Integration von IT- und OT-Netzwerken erhöht das Risiko zusätzlich.
Unserer Meinung nach sollte die Regierung den Unternehmen nicht nur Verpflichtungen auferlegen, sondern ihnen auch konkrete Unterstützung bieten. Erforderlich sind Mindeststandards und obligatorische Audits, aber auch – parallel dazu – unterstützende Instrumente : Förderprogramme, Steuererleichterungen, zentrale Überwachungsplattformen (SOC-as-a-Service) und Datenbanken mit Verfahren zur Reaktion auf Vorfälle.
Auch Aufklärung ist von entscheidender Bedeutung: Schulungen, Kampagnen und Simulationsübungen. Ohne umfassende Maßnahmen, die Prävention, Prävention, Aufklärung und technologische Unterstützung kombinieren, wird die polnische Industrie zunehmend anfällig für Zwischenfälle sein, deren Auswirkungen über einzelne Anlagen hinausgehen und die Stabilität der Wirtschaft beeinträchtigen können.
wnp.pl





