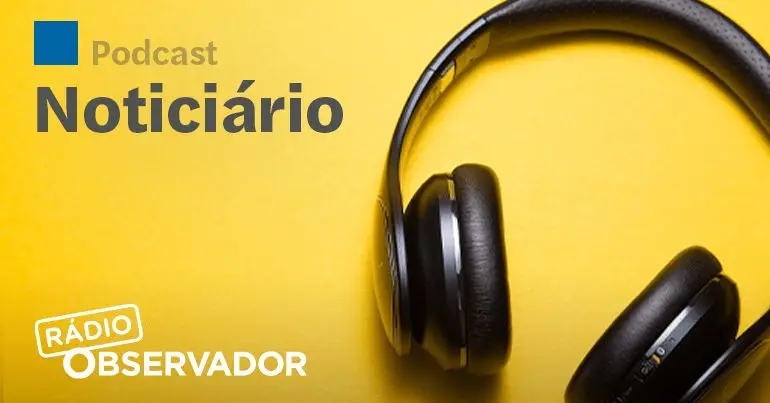Konzil von Nicäa, Leo XIV. und die Synodalität

Ende Juli 2025 jährt sich der Abschluss des Konzils von Nicäa (ein Ort am Ostufer eines Sees im heutigen asiatischen Teil der Türkei, 20 Kilometer südwestlich des heutigen Istanbul) zum 1700. Mal, wenn es als Erstes Ökumenisches Konzil (das allen Bischöfen der Kirche offen stand) angesehen wird.
Heute verstehen die meisten von uns (ob treu oder nicht) nichts von dem, was dort geschah und die Entstehung der sogenannten „westlichen“ Zivilisation ermöglichte, wenn wir „Nicäa“ hören. Das ist eine Schande. Aber jeder hat das Recht auf seine Unwissenheit und Blindheit, die im Hinblick auf dieses Konzil jahrelang von Sekten und verzweifelten Autoren ausgenutzt wurde, um die Geschichte zu verfälschen.
Gleichzeitig halten diese Verfälschungen der Weisheit von Menschen mit einem durchschnittlichen Allgemeinwissen nicht mehr stand. Zu solchen Verfälschungen zählen etwa die Behauptung, Jesus sei bei diesem Ereignis zum ersten Mal als Gott bezeichnet worden; diese Aussage sei von Kaiser Konstantin I. auferlegt worden; das während dieses Konzils verfasste Glaubensbekenntnis habe keine biblische Grundlage; usw.
Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass das Schlüsselwort dieses Glaubensbekenntnisses („homoousios“) gnostischen Ursprungs und gnostischer Bedeutung sei (eine parasitäre Bewegung des Christentums, die es zur Strukturierung des „Sammelsuriums von Themen“ aus nahezu allen Quadranten verwendete, die es vermittelte).
Was seine Herkunft betrifft, so ist es eine Tatsache, dass der Begriff „homoousios“ nach heutigem Kenntnisstand zuerst von den Gnostikern verwendet wurde, in Nicäa jedoch nicht mehr verwendet wurde. Seine Bedeutung ist völlig falsch. Kein Gnostiker hatte jemals die Absicht, diesem griechischen Wort die Bedeutung zu geben, die es in Nicäa erhielt, dem Ergebnis der Arbeit von Hosius von Córdoba und Alexander von Alexandria an der Übersetzung des lateinischen „consubstantialem“ (das über 100 Jahre zuvor von Tertullian von Karthago verfasst und verbreitet worden war).
Darüber hinaus übersetzen diese Begriffe (ob nun das in Nicäa verwendete Griechisch oder das ältere Latein) perfekt (und dies war die gewünschte orthodoxe Bedeutung, trotz der späteren eitlen sprachlichen Manipulationen durch Gegner dieser Orthodoxie) die Aussage „Ich [Jesus] und der Vater sind eins“ aus Johannes 10,30. Tatsächlich erscheint das „eins“ im Griechischen Neutrum, was auf eine absolute Gleichheit in Bezug auf das natürliche Wesen (die Göttlichkeit) von Jesus und dem Vater hinweist. Dies ist also die gewünschte Bedeutung des nizänischen „wesensgleichen“.
Doch es geht mir nicht um diesen Begriff, über den ich weiter schreiben möchte. Angeregt durch eine Rede Leos XIV. vor den italienischen Bischöfen vor einem Monat möchte ich vielmehr auf das Wort „apostolisch“ aufmerksam machen, das im Nicänischen Glaubensbekenntnis als wesentliches und konstitutives Merkmal der Kirche verwendet wird. Warum? Weil es, wie das Zweite Vatikanische Konzil richtig erkannte, auf eine „Apostolizität“ hinweist, die dieses Konzil mit „Kollegialität“ übersetzte.
Es bedarf tatsächlich einer gewaltigen Verrenkung (die übrigens auch von berühmten Persönlichkeiten versucht wurde), um zu behaupten, „Kollegialität“ und „Apostolizität“ seien reine Synonyme für „Synodalität“. Das sind sie aber nicht. Dies zeigt sich vor allem daran, dass die in Nicäa Versammelten sagten, die Kirche sei „eine, heilige, katholische und apostolische“ (und nicht „synodale“), und dass die Teilnehmer des Zweiten Vatikanischen Konzils von „Kollegialität“ (und wiederum nicht von „Synodalität“) sprachen.
Leo XIV. verdeutlichte in der erwähnten Rede (die noch nicht ins Portugiesische übersetzt wurde; die Übersetzung aus dem Italienischen liegt allein in meiner Verantwortung) den offensichtlichen Unterschied zwischen dem Wesentlichen und dem Instrumentalen und dem Operativen. Lassen Sie uns nun seinen Gedankengang aufmerksam und kurz verfolgen.
Gleich zu Beginn, fast zu Beginn der Abschrift der Rede Benedikts XIV., können wir lesen: „Bei der Ausübung meines [Petrus-]Dienstes mit euch, liebe Brüder [Bischöfe], möchte ich mich an den Prinzipien der Kollegialität orientieren, die das Zweite Vatikanische Konzil entwickelt hat“ (…) „So seid ihr berufen, euren Dienst zu leben: in Kollegialität untereinander und in Kollegialität mit dem Nachfolger Petri“ (§ 3).
Am Ende seiner Ansprache und nachdem er die Prioritäten der bischöflichen Arbeit aufgezeigt hat, stellt der Papst klar: „Geht in der Einheit voran und denkt dabei vor allem an den Synodalen Weg. (…) Möge die Synodalität zu einer Mentalität werden, in unseren Herzen, in unseren Entscheidungsprozessen und in unserer Handlungsweise“ (§ 12).
Die Reihenfolge der Begriffe „Kollegialität“ und „Synodalität“ im Text des Papstes erscheint mir keineswegs zufällig. Im Gegenteil: Die apostolische Kollegialität (von der kaum noch gesprochen wird) taucht als grundlegende Realität der Ekklesiologie wieder auf, nachdem einzelne Bischöfe aufgrund verschiedener Umstände abgewertet worden waren. Nämlich: i) die päpstliche Hypertrophie des Ersten Vatikanischen Konzils; ii) die „Bischofssynode“; iii) und die „Bischofskonferenzen“.
(Beachten Sie en passant : Was ein Bischof mit Autorität sagt, hat [für die Menschen, denen er dienen soll] einen höheren Wert als die Feststellungen der letzten beiden Fälle, die ich gerade erwähnt habe, weil das apostolische Episkopat im Gegensatz zu diesen göttlichen Ursprungs ist.)
Nun, das erwähnte „Wiederauftauchen“ des Begriffs „Kollegialität“ zeigt, dass es sich um ein grundlegendes Prinzip handelt und nicht nur um eine Eigenschaft unter anderen (auch nicht um etwas Künstliches und Geschichtlich Verwurzeltes). Es ist ein ursprüngliches Element, das zudem von Jesus selbst gewollt wurde und wird (vgl. § 12): eine geistliche Gemeinschaft mit Petrus und unter Petrus, um in jedem Zeitalter das zu beten, was für die Erfüllung der Kirche und ihrer Mission notwendig ist (wie Christus vor 2000 Jahren sagte).
„Synodalität“ wird ihrerseits als bloße Eigenschaft der Kirche verstanden; als „Mittel“ und nicht als „Ziel“. Ein „Mittel“ und ein Weg, „Kollegialität“ zu leben und das oben genannte „Ziel“ zu erreichen: die Einheit in Christus Jesus. Für Papst Leo ist die wahre Bedeutung von „Synodalität“ etymologisch: „gemeinsam unterwegs sein“, nicht das kirchliche Ganze, das sie zum Ausdruck bringt. „Synodalität“ hat keinen Wert an sich; sie funktioniert vielmehr im Sinne des oben genannten „Ziels“.
Im Wesentlichen sagt Leo XIV.: „Die ontologische apostolische Kollegialität muss mit einer synodalen Mentalität gelebt werden, damit der gesamte bischöfliche Körper in und in der Einheit lebt“, und dies auch (ich wage hinzuzufügen), damit dieser Wunsch nach der Einheit Christi somit eine Realität unter allen Mitgliedern seiner Kirche ist und nicht ein Kind von Morpheus.
Wenn wir nun nach Nicäa zurückkehren und den von mir dargelegten Rahmen zur Beziehung zwischen „Kollegialität“ und „Synodalität“ betrachten, sehen wir, dass der orthodoxe Glaube unabhängig von den Umständen immer bestehen bleibt, wenn man dem Heiligen Geist gestattet, in der Kirche, die er belebt, lebendig zu sein.
1700 Jahre lang war es verboten (als ob dies möglich wäre, da jeder, der von der Orthodoxie der Kirche abweicht, nie zu ihr gehörte [vgl. 1 Johannes 2,19]), ontologisch mit der Kirche zu brechen und die wahre und volle Göttlichkeit Gottes, des Sohnes, und die göttliche Natur dieses fleischgewordenen Gottes, des Sohnes (Jesus), zu leugnen. Heute bemüht sich Leo XIV. darum, dass niemand den Fehler begeht, die „Einberufung (zur Kommunion)“ zu brechen und damit das Verhältnis zwischen „Kollegialität“ und „Synodalität“ umzukehren.
Die Väter von Nicäa erlösten die Jünger Jesu vom Irrtum und führten uns zum wahren Glauben Christi; heute (so scheint es mir) folgt Leo XIV. ihrem Beispiel. Und wenn wir uns stets mit Freude und Dankbarkeit an diese Väter erinnern sollten (im Wissen, dass keiner der Getauften unserer Zeit ohne ihren Einsatz ein Christ wäre), bin ich zunehmend davon überzeugt, dass dies auch für den heutigen Papst angebracht ist (der die „Synodalität“ heilsamer gestaltet).
observador