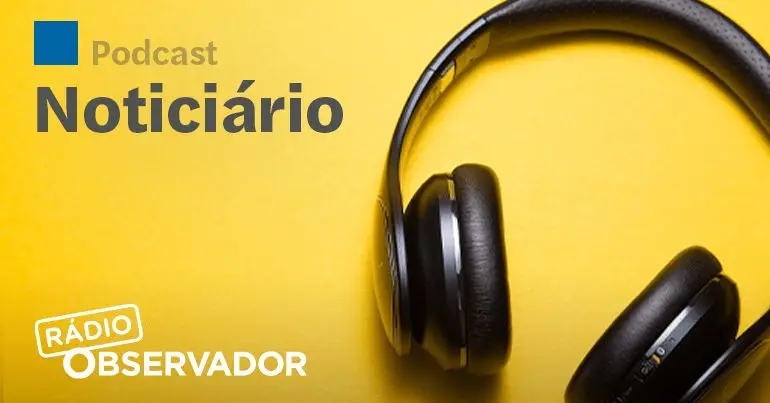(2) Wird die Universität ersetzt?

In einem früheren Artikel wurde die aktuelle Situation der Universität diskutiert und Fragen zu ihrer Zukunft aufgeworfen. Hier besprechen wir die wichtigsten Herausforderungen, denen Sie heute gegenüberstehen.
Die Universität war von den großen sozialen und technologischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte betroffen: dem Fall der Berliner Mauer (1989) und der Krise der Ideologien; der Niedergang der Nationalstaaten und die Entstehung transnationaler politischer Organisationen (z. B. Vertrag von Maastricht, 1992); wirtschaftliche, kulturelle und wissensbezogene Globalisierung; wissenschaftlicher Fortschritt und technologische Innovationen mit starker gesellschaftlicher Wirkung; Sorge um die Umwelt; neue Märkte und Geschäftsmodelle; die konsequente Neudefinition beruflicher Qualifikationen im Rahmen der sogenannten 4. Industriellen Revolution. In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Universität Herausforderungen, die ihre Mission, ihre Ziele und ihre Handlungsweise gefährden.
1) Ende des Monopols: von Wissen, Bildung und akademischen Graden
Wissen, eines der wertvollsten Güter der Universität, war jahrhundertelang innerhalb ihrer Mauern eingeschlossen. Heute ist es jedoch allgegenwärtig, insbesondere im Hochschulbereich. Die Wissensgenerierung findet zunehmend auch außerhalb der Universität statt, nämlich in Spitzentechnologieunternehmen und bei Big Tech. Der einfache und unmittelbare Zugriff auf vielfältige Informationsquellen erleichtert das Selbststudium und ermöglicht neue Formen des informellen Lernens außerhalb der Universität. Die Universität hat ihre Wissenshegemonie verloren.
Bewegungen wie Open Educational Resources (OER) , die von der UNESCO vorangetrieben werden, und virtuelle Lernumgebungen wie Massive Open Online Courses (MOOC) oder Small Private Online Course (SPOC) ermöglichen einen nie dagewesenen Zugang zu Wissen. Heutzutage gibt es Möglichkeiten zur Online- Wissensvermittlung, und zwar in einer äußerst hochwertigen und so klaren, überzeugenden und effektiven Art und Weise, dass sie die meisten Lehrveranstaltungen an traditionellen Universitäten übertrifft. Bildung ist nicht länger ein Monopol der Universität.
Auch die Verleihung akademischer Grade als Nachweis von Bildung wird in Frage gestellt. Einige Online-Plattformen stellen nicht nur Inhalte bereit, sondern bewerten die Studierenden auch und stellen „Zertifikate“ aus. Diese haben möglicherweise keinen Rechtswert, haben jedoch einen „Marktwert“, wenn sie von den Arbeitgebern anerkannt werden. Die Zertifizierung ist nicht länger ein Monopol der Universität.
2) Antagonistische Kräfte und widersprüchliche Erwartungen
Die Universität steht heute vor dem Dilemma, dass sie in eklatantem Widerspruch dazu aufgefordert wird, alles und gleichzeitig das Gegenteil auf scheinbar unvereinbare Weise zu tun:
– Es müssen „intellektuelle Eliten“ und zugleich „qualifizierte Arbeitskräfte“ ausgebildet werden. Doch ist es möglich, die Ausbildung kultureller, wissenschaftlicher und politischer Führungspersönlichkeiten (mit einer humanistischen, kritischen und reflektierenden Ausbildung) mit der Massenbildung in Einklang zu bringen, um den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden?
– Sie hat eine internationale/universelle Mission und muss sich gleichzeitig an lokale Probleme anpassen und darauf reagieren. Aber ist die universelle Mission gleichbedeutend mit dem Beitrag zur regionalen Entwicklung?
– Ihre wissenschaftliche, pädagogische und kulturelle Autonomie wird befürwortet, doch in vielen Fällen stehen der staatlichen Unterfinanzierung und dem daraus resultierenden Bedarf an eigenen Einnahmen diese Autonomie entgegen;
– Es muss ein Raum geistiger Freiheit sein, der für unabhängiges und unvoreingenommenes kritisches Denken offen ist, gleichzeitig aber von unmittelbaren Produktivitätskriterien und Kennzahlen zur Geschäftseffizienz wie KPI (Key Performance Indicator) bestimmt werden muss;
3) „Konkurrierende“ Alternativen
Da die Universität nicht alles und das Gegenteil gleichzeitig leisten kann, werden insbesondere im Bildungsbereich immer häufiger Alternativen angeboten. Die im Silicon Valley ansässige Singularity University definiert sich beispielsweise als „Lernplattform“, die aus einer „globalen Community oder einem Netzwerk von Experten“ besteht. Auf privater Initiative und mit Finanzierung durch multinationale Konzerne bietet es Kurzkurse im Bereich Technologie und Innovation an.
Google ist auch in den Bereich der Online-Bildung eingestiegen und bietet auf der Coursera- Plattform sogenannte Google Professional Certificates an. Dabei handelt es sich um flexible, kostengünstige Kurse in stark nachgefragten Bereichen wie KI, Daten, Cybersicherheit, Projektmanagement usw. Das Projekt wurde zunächst mit impliziter Kritik am traditionellen Lehrmodell vorgestellt, allerdings mit der Absicht, es mit traditionellen Universitätskursen zu vergleichen.
Escola 42 ist ein weiteres Beispiel für Disruption und Erfolg im Bereich der alternativen Bildung zur Universität. Es wurde 2013 in Frankreich zum Programmierenlernen gegründet, wird von Mäzenen finanziert und ist für Studenten kostenlos. Es ist in mehr als 50 Städten in rund 30 Ländern vertreten, darunter Lissabon und Porto . Sie gilt als exzellente Programmierschule und ihre Studenten sind bei Arbeitgebern sehr gefragt. In die gleiche Richtung gehen auch andere Initiativen wie Le Wagon (2013), Holberton School (2015) oder BloomTech (2017).
Die Khan Academy ist ein weiteres Beispiel für eine Institution, die „kostenlose, erstklassige Bildung für jedermann und überall“ anbietet. Ihr Lehrmaterial, insbesondere die Videos, wurde Hunderte Millionen Mal angesehen.
Es entstehen weiterhin Alternativen mit unterschiedlichen Ansätzen, die von NGOs, gemeinnützigen Organisationen oder Unternehmen gefördert werden. Im Bereich Wirtschaft und Unternehmertum stechen Initiativen wie thePower (2017) oder Hyper Island (1996) hervor. Bootcamps , die auf dem Arbeitsmarkt immer beliebter werden, sind ein weiteres Beispiel für diesen Wandel im Bildungswesen.
Diese alternativen Bildungsformen können praktisch jeden überall und jederzeit erreichen. Sie zeichnen sich durch schnelle, kurzfristige Lehrmethoden aus und viele Kurse sind kostenlos. Sie entsprechen zwar nicht ganz der traditionellen Universität, stellen aber eine Alternative dar. Da sie in den letzten 15 Jahren entstanden sind, ist es möglich, dass sie zunehmend attraktiver werden und mit den traditionellen Universitäten um immer mehr Studenten konkurrieren.
Paradoxerweise tragen die Universitäten selbst zur Transformation der Hochschulbildung bei, indem sie die Inhalte ihrer Lehrpläne kostenlos zur Verfügung stellen, darunter auch Videos von Vorlesungen (z. B. MIT oder IIT ). Dies hat auch zu einem Paradigmenwechsel im Verhältnis zwischen Studierenden und Hochschulen beigetragen.
4) Die Universität ist in mehreren Funktionen ersetzbar
Zu den traditionellen Aufgaben der Universität gehört die Zertifizierung und Einstufung der Studierenden durch Diplome und Studiendurchschnitte. Dies war für Unternehmen relevant, die Universitäten als unverzichtbaren „Dienstleister“ für die Personalbeschaffung betrachteten. Heute wird diese Rolle der Universität jedoch durch hochentwickelte Bewertungs- und Rankingdienste sowie Rekrutierungsmechanismen (z. B. WeCP , HireVue ) ersetzt. Aus dieser Sicht verlieren das akademische Diplom und seine Qualifikation zwangsläufig an Wert.
Tatsächlich entstehen in vielen Bereichen immer mehr Alternativen zu den Universitäten, was die Ausbildung, Beurteilung, Auswahl und Einstellung von Fachkräften angeht. Diese Funktionen allein rechtfertigen weder die Existenz noch die gesellschaftliche Relevanz der Universität. In gewisser Weise scheint sich ein Zyklus seinem Ende zu nähern, der vor 200 Jahren mit der Schaffung des napoleonischen Modells begann: die Universität als Instrument zur Ausbildung und Auswahl von Fachkräften.
5) Viele Studenten empfinden die Universität als etwas Nutzloses
Ausgehend von den vier vorherigen Punkten ist es nicht verwunderlich, dass viele Studenten die Universität kritisieren und abbrechen, weil sie behaupten, dass sie für ihr Leben nutzlos sei. Es gibt ein starkes soziales Bild von Unternehmern, denen zufolge ihr Erfolg auf eine Universität zurückzuführen ist (Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Richard Branson (Virgin), Jan Koum (WhatsApp), Travis Kalanick (Uber) usw.). Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass es sich hierbei um Ausnahmefälle handelt und eine formale Ausbildung in der Regel der sicherste Weg zu Stabilität und beruflichem Erfolg ist. Wenn Sie also auf YouTube nach „Dropped out of college“ suchen, finden Sie Tausende von Videos mit Millionen von Aufrufen, die sich für Studienabbrecher stark machen. Wenn die Bedeutung von Wissen anerkannt wird, geht man davon aus, dass es durch informelles Lernen außerhalb des universitären Kontexts erworben wurde.
Gleichzeitig legen vor allem in den USA immer mehr Unternehmen keinen Wert mehr auf den Abschluss eines Hochschulstudiums und stellen ihre Mitarbeiter unabhängig davon ein, ob sie eine Universität besucht haben. Gemäß der Einstellungspolitik mehrerer Unternehmen ( Apple , Google , IBM , PwC , Aon ) ist nicht mehr der akademische Abschluss das Hauptkriterium, sondern die Fähigkeiten der Kandidaten für bestimmte Ziele. Anschließend bieten sie gezielte Inhouse-Schulungen an. Wird dies im Kontext einer hohen wissenschaftlichen und technologischen Komplexität langfristig tragfähig sein? Ermöglicht die Reaktion auf die unmittelbaren Bedürfnisse von Unternehmen eine Führungsrolle und Nachhaltigkeit des technologischen Fortschritts?
6) Lehrmethoden gelten als veraltet
Was Lehrmethoden, Unterricht und Lernmaterialien angeht, gelten sie im Vergleich zu anderen, unmittelbareren, interaktiveren oder unterhaltsameren Möglichkeiten der Wissensaneignung als langweilig, altmodisch und ineffektiv. Besonders kritisch sieht dies die sogenannte Generation Z ( Zapping ), die Digital Natives der Jahrgänge 1995 bis 2010.
7) Wirtschaftliche Belastungen
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Investition von Studenten in eine Hochschulausbildung nicht immer rentabel, wie beispielsweise in den USA, wo die Verschuldung von Studenten ein ernstes Problem darstellt.
Obwohl die durchschnittlichen monatlichen Kosten für ein Universitätsstudium in Portugal bei etwa 900 € liegen, bietet es erhebliche Vorteile hinsichtlich der Beschäftigungsfähigkeit und des langfristigen Einkommens. Portugal ist eines der europäischen Länder mit der höchsten Rendite für jedes zusätzliche Schuljahr. Laut dem OECD-Bericht von 2024 beträgt der mit einem Hochschulabschluss verbundene Lohnaufschlag in Portugal 73 % , während der OECD-Durchschnitt bei 56 % liegt. Betrachtet man alle Altersgruppen, ist die Arbeitslosenquote in Portugal unter den Universitätsabsolventen niedriger. Betrachtet man allerdings nur die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, war die Arbeitslosenquote in Portugal in manchen Jahren unter den Hochschulabsolventen höher als unter denjenigen, die nur die Sekundarstufe abgeschlossen hatten.
8) Die VICA-Welt
In einer unbeständigen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen (VICA) Welt argumentieren einige, dass sich die „Fähigkeiten“ und die Ausbildung, die zur Bewältigung aktueller Probleme (technologischer, sozialer, ökologischer) erforderlich sind, schnell ändern und dass die heute gelehrten Inhalte morgen schon veraltet sein werden. Daher wird argumentiert, dass ein fünfjähriger Universitätskurs fürs Leben keinen Sinn ergibt, sondern lebenslanges Lernen. Die Alternative wäre, die fünf Jahre damit zu verbringen, „das zu lehren, was sich nie ändert“, also im Fall der MINT-Fakultäten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) die wissenschaftlichen Grundlagen, die jeder aktuellen oder zukünftigen Technologie zugrunde liegen. Dieser Ansatz würde jedoch dazu führen, dass die Ausbildung als „rein theoretisch“ und ohne unmittelbare praktische Anwendung betrachtet würde, was zu dem Vorwurf führen würde, dass die Universität den Studierenden nicht die Fähigkeiten vermittelt, die zur Lösung praktischer Probleme der Gesellschaft erforderlich sind. Das Problem ist daher zirkulär und paradox.
In der hochgradig globalisierten VICA-Welt macht auch das Humboldtsche Universitätsmodell keinen Sinn mehr. Mit anderen Worten: Die Universität hat als Ausbilderin von „nationalen Bürgern“, als Generatorin und Hüterin der „nationalen Kultur“ an Bedeutung verloren, denn in der VICA-Welt ist alles international und global. Wie Bill Readings bemerkte, verliert die Universität mit dem Verschwinden der Nationalstaaten und kulturellen Identitäten ihre Funktion als Hüterin der nationalen Kultur. Die überraschenden Ereignisse der letzten Wochen geben jedoch Anlass zur Frage, ob die Globalisierung auch weiterhin den Hintergrund für die Entwicklung der Universitäten bilden wird …
9) Die entführte Universität
Die Anfälligkeit der Universität für externe Einflüsse, die nichts mit ihrer Mission zu tun haben, ist nichts Neues. An geisteswissenschaftlichen Fakultäten besteht die Gefahr einer „ideologischen Entführung“, da sie ein attraktives Ziel für politische Instrumentalisierung darstellen. Sie ermöglichen die Einflussnahme auf zukünftige Führungskräfte, indem sie die Produktion und Verbreitung von Wissen kontrollieren. Das Wissen richtet sich an junge Menschen, die wachsam, beeinflussbar und für Idealismus und Aktivismus offen sind. DiePort Huron Declaration (1962) ist ein Beispiel für diesen wiederkehrenden Wunsch, die Universität zur Förderung politischer Agenden und Ideologien zu instrumentalisieren. In den letzten Jahren waren auf vielen Universitätsgeländen die Cancel Culture und Angriffe auf die Meinungsfreiheit weit verbreitet. In einigen Fällen geht die Einmischung von anderen Staaten aus, wie beispielsweise der finanzielle und politische Einfluss Chinas auf die Universität Cambridge – Wie China Cambridge kaufte .
In MINT-Fakultäten besteht die Gefahr einer „wirtschaftlichen Entführung“, da die Entwicklung mancher Technologien für Unternehmen von großem Interesse sein kann. Dies könnte zu einem übermäßigen Einfluss auf die Forschungsstrategie und die Studiengangsgestaltung führen und Vorurteile schaffen, die die Berufung der Universität, ihre Autonomie und ihre Distanz zu privaten Gruppen gefährden.
Damit verbunden ist der (teilweise bereits umgesetzte) Versuch, die Universität in eine bloße marktfähige Dienstleistung umzuwandeln und die Lehrveranstaltungen auf etwas zu reduzieren, das ausschließlich anhand von „Lernergebnissen“ gemessen werden kann. Wichtigster Ausdruck dieser Entwicklung ist der internationale Vertrag GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) der Welthandelsorganisation (WTO) aus dem Jahr 1995, der die Universitäten in die Regelung des internationalen Handels einbezog. Letztlich würden die Universitäten eher zu Berufsbildungszentren tendieren, die sich auf praktische Fähigkeiten konzentrieren und sich an den Bedürfnissen des Marktes orientieren, ähnlich dem Konzept der EIT Digital Master School , auf Kosten einer kritischen, reflektierten und umfassenden Bildung.
10) Die erstickende Bürokratie
Die Universität ist, wie andere Organisationen auch, zu einem derart schweren bürokratischen Komplex geworden, dass er die beste Arbeit, die dort geleistet werden sollte, beinahe lähmt. Zahlreiche Protokolle, Verfahren, Vorschriften, Standards, Anordnungen, Berichte, Dokumente, Formulare, Sitzungen, Ausschüsse, Beurteilungen, Wettbewerbe, Unterschriften, Rundschreiben, E-Mails, digitale Plattformen, Entlassungen, Bedeutungslosigkeiten und andere unproduktive Hindernisse übersteigen jede Vernunft.
Es stimmt, dass dies kein ausschließlich an der Universität auftretendes Problem ist – es handelt sich um eine Lebensweise, die weit verbreitet ist und zwei Komponenten hat: i) ständige Ablenkung, ähnlich der Brownschen Bewegung, ermöglicht eine kontinuierliche Entfremdung vom Aufwachen bis zum Schlafengehen und hindert jeden daran, innezuhalten, um über das Wesentliche des Lebens nachzudenken, was zu einer Krise führt; ii) Andererseits geschieht alles auf der Grundlage von Misstrauen gegenüber der individuellen Autonomie und der Schuldvermutung. Wie GK Chesterton sagte: „Wenn die Menschen die Zehn Gebote nicht befolgen, werden sie am Ende Zehntausend Gebote befolgen.“
Diese ständige bürokratische Zerstreuung führt nicht nur zu Verschwendung und Demotivation, sondern ist für die Universität besonders schädlich, da sie die Professoren daran hindert, ihre akademische Berufung voll auszuleben, denn sie sind nicht nur „Lehrpersonal“: Die Universität ist im Wesentlichen auf die Verfügbarkeit und Initiative ihrer Professoren angewiesen. Sie verbringen jedoch endlose Stunden in Besprechungen, in denen sie die zahllosen unproduktiven Hindernisse diskutieren, sind jedoch selten mit wirklicher Ruhe im Labor ( laboratorium, von laborare , was arbeiten bedeutet) und treffen sich selten, um wirklich akademische Angelegenheiten zu besprechen …
Der Universität fehlen Kreuzgänge und Agoras!
Nach dieser Betrachtung der wichtigsten Herausforderungen, vor denen die Universität steht, befasst sich der nächste Artikel mit ihrer historischen Entwicklung bis zum heutigen Tag.
Die hier geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und nicht die der Institutionen, denen er angehört.
observador